Was ist ein Trauma?

Das Wort „Trauma“ stammt aus dem griechischen und bedeutet soviel wie „Wunde“. In der Psychologie bezeichnet ein Trauma eine starke negative Erfahrung, die sich langfristig auf das Leben auswirkt. Im Folgenden werde ich einen kurzen Überblick zu Ansätzen und Erklärungen der Neurobiologie für Psychotraumata geben. Dabei komme ich nicht umhin, einige komplizierte Fachbegriffe zu benutzen, aber ich versuche, diese Einsichten allgemeinverständlich zu übersetzen.
Der signifikante Einfluss von Traumata
Für das Thema Trauma sensibilisieren sich allmählich immer mehr Menschen. Durch die seit Freud einsetzende Forschung im Bereich der Psychologie hat die Bedeutung frühkindlicher Prägungen eine breite Akzeptanz erfahren. Heute wird sie durch die Neurobiologie mehr und mehr untermauert. Das heißt, dass Traumata als Forschungsgegenstand längst nicht mehr nur ein „bloß“ psychologisches ist. Denn noch immer hält sich das Vorurteil, dass Psychologen Probleme „ja nur daherreden“. Im Gegenteil ist der starke Einfluss von traumatischen Erfahrungen neurobiologisch sehr gut nachgewiesen:
„Der Zusammenhang zwischen frühen Traumatisierungen in der Kindheit und einem erhöhten psychischen Erkrankungsrisiko ist in der Fachliteratur seit Langem gut belegt.“ [4]
Sigmund Freuds Einsicht in die Bedeutung (früh)kindlicher Erfahrungen, und damit die Grundlage aller psychologischen Theorien und Therapien, wurde in dieser Hinsicht also naturwissenschaftlich bestätigt.
Wie funktioniert eine Traumatisierung?
Eine wichtige Erkenntnis der Neurobiologie über Trauma: Traumatische Erfahrungen werden anders verarbeitet als normale Erfahrungen. Als Faustregel kann gelten: je intensiver das Gefühl bei einem bestimmten Erlebnis ist, desto intensiver ist auch die Erinnerung daran. Traumatische Erfahrungen sind so überwältigend, dass auch die Erinnerung daran überwältigend ist:
„Bei der Einspeicherung traumatischer Erinnerungen scheint es nun zu Alterationen des autobiografisch-episodischen Gedächtnisprozesses zu kommen, die durch fehlenden Selbst-Bezug und durch eine inhaltliche Fragmentierung und Desorganisation charakterisiert sind.“ (Flatten)
Das bedeutet, dass der präfrontale Kortex (der eine große Rolle für das bewusste Erleben und das bewusste Abrufen von Erinnerungen spielt) bei traumatischen Erfahrungen überfordert ist. Daher wird er quasi umgangen. Die Erinnerung speichert sich in tieferen, vorbewussten Schichten des Selbst ab und ist daher nicht bewusst zugänglich. Deswegen muss der oder die Klient*in einen Selbsterkenntnisprozess durchlaufen, um diese sensiblen Bereiche in das Bewusstsein holen zu können, ohne das Trauma zu reaktivieren.
Die Schwere einer Traumatisierung kann natürlich stark variieren und hängt von mehreren Faktoren ab. Z.B. ob eine ähnliche Erfahrung wiederholt erlebt worden ist, in welchem Alter ich sie mache u.v.m. Außerdem kann ein Trauma unter günstigen Umständen (Ressourcen im Umfeld, eigene Resilienz, …) auch gut „abgefangen“ werden.
Die traumabedingte Angst-Reaktion
Die Angst-Reaktion fasst Flatten folgendermaßen zusammen. Ich werde die komplizierten Begriffe direkt im Anschluss erklären.
„Die traumatische Wahrnehmung bleibt auf der Ebene limbischer Verarbeitung ’stecken‘, sodass erfahrungs- und vernunftbasierte Bewertungen durch präfrontale Kortexregionen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die funktionelle Abkopplung präfrontaler Steuerungsfunktionen resultiert in:
- einer fehlenden Top-down-Hemmung der amygdalären Alarmreaktionen
- einer gestörten Einbindung des Sprachzentrums (Broca-Areal) mit erschwerter Verbalisierung
- einer Beeinträchtigung des Selbstwirksamkeits- und Agency-Erlebens (Derealisation, Depersonalisation)“ (Flatten)
Was bedeutet das?
Das limbische System ist ein evolutionär sehr altes System, dass die Emotionen und die Triebe reguliert. Was im limbischen System abgespeichert ist, entzieht sich einer bewusst-rationalen Kontrolle. Diese Kontrolle wird normalerweise durch den präfrontalen Kortex ausgeübt, der für bewusstes Denken, Entscheidungen und Gedächtnisbildung zuständig ist. Insgesamt bedeutet das also, dass man bei einer traumabedingten Angst-Reaktion keine Chance hat, auf „vernünftiges Zureden“ beispielsweise zu reagieren.
Fehlende Top-down-Hemmung der amygdalären Alarmreaktionen: Das Problem bei einem Trauma ist aus Sicht der Neurobiologie, dass sowohl die traumatische Erfahrung selbst, als auch die Erinnerung daran, die Amygdala aktivieren kann. Die Amygdala ist so etwas wie ein Feueralarm für gefährliche Situationen. Sie löst evolutionär tief verankerte Reaktionen aus, die zu Kampf, Flucht oder zu Erstarren führen („fight, flight or freeze“). Wird diese Alarmreaktion ausgelöst, ist sie sehr schwer zu hemmen. Das Perfide: diese Alarmreaktion kann durch bestimmte Reize getriggert werden, ohne dass das dem oder der Betroffenen bewusst wird!

Die Störung des Sprachzentrums erklärt auch aus der Perspektive der Neurobiologie, warum sich ein tiefliegendes Trauma schwer verbalisieren lässt. Es entzieht sich rein sprachlicher Aufklärung und muss daher auf grundlegenderer Ebene bearbeitet werden. Betroffene können also in einer Angst-Situation kaum ausdrücken, was in ihnen vorgeht. Die Sprache ist tendenziell unzusammenhängend und undeutlich.
Beeinträchtigung des  Selbstwirksamkeitserlebens: Wie in der traumatischen Erfahrung selbst, in der man sich als ohnmächtig erlebt, bewirkt auch die Reaktivierung der Angst-Reaktion ein Gefühl der Ohnmacht. Dieses kompensiert die Psyche durch Depersonalisation oder Derealisation, also dem Gefühl der Entfremdung von sich selbst oder von der Wirklichkeit. Man erlebt die Situation so, als ob man gar nicht direkt daran beteiligt wäre. Ein Gefühl der Gefühllosigkeit stellt sich ein.
Selbstwirksamkeitserlebens: Wie in der traumatischen Erfahrung selbst, in der man sich als ohnmächtig erlebt, bewirkt auch die Reaktivierung der Angst-Reaktion ein Gefühl der Ohnmacht. Dieses kompensiert die Psyche durch Depersonalisation oder Derealisation, also dem Gefühl der Entfremdung von sich selbst oder von der Wirklichkeit. Man erlebt die Situation so, als ob man gar nicht direkt daran beteiligt wäre. Ein Gefühl der Gefühllosigkeit stellt sich ein.
Wie sich Trauma aus Sicht der Neurobiologie auf das Leben auswirkt
„Frühe massive Störungen des Stressverarbeitungssystems (CRF-Cortisol) sowie des Selbstberuhigungssystems (Serotonin) sind besonders schicksalhaft, weil die Fehlregulation des CRF-Cortisol-Haushalts langfristiger Natur ist und zudem die Ausbildung der anderen psychoneuronalen Systeme stark beeinflusst, und weil der Serotoninspiegel einen nachhaltigen Einfluss auf die allgemeine Hirnentwicklung hat.“ (Roth, Strübel)
Das bedeutet, durch traumatische Erfahrungen wird die Reaktion auf Stressfaktoren in der Umwelt stark beeinflusst. So können für Menschen mit PTBS (Posttraumatischer Belastungsstörung) bereits kleine Triggerreize das Stressverarbeitungssystem überreagieren lassen.
Durch langfristigen hohen Stress wiederum enstehen neurotoxische Effekte u.a. durch Cortisol, die die Wahrnehmung und Gedächtnisleistung dauerhaft beeinträchtigen können! (Flatten). Traumatisierte Menschen leben gewissermaßen mit einem Filter, durch den sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dieser Filter verstärkt bestimmte Aspekte, während andere ausgeblendet werden. Die Wahrnehmung selektiert also mehr, als bei gesunden Menschen.
Trauma und Körper
Dass sich traumatische Erfahrungen insbesondere auf das Körpergedächtnis bzw. Muskelpanzer auswirkt, wurde vom Freudschüler Wilhelm Reich und dessen Schüler Michael Lowen als eine wichtige Erkenntnis angesehen. Auf dieser Erkenntnis haben sie dann auch ihre Therapien begründet und sie ist ebenfalls neurobiologisch plausibel. Dafür muss man zunächst einmal verstehen, dass das Gehirn keineswegs eine separate Schaltstelle ist, die den Körper steuert, sondern dass das Gehirn auf das engste mit dem Körper verbunden ist:
„Im hoch entwickelten Gehirn der komplexeren Lebewesen jedoch ahmen Neuronennetzwerke irgendwann den Aufbau der Körperteile nach, denen sie zugeordnet sind. Sie repräsentieren den Zustand des Körpers, indem sie ganz buchstäblich eine Landkarte des Körpers, für den sie arbeiten, darstellen und eine Art virtuelles Abbild, ein neuronales Double, schaffen. Wichtig ist dabei, dass sie während des ganzen Lebens mit dem Körper verbunden bleiben, den sie nachahmen.“ (Damasio)
Wenn wir uns von traumatischen Erfahrungen lösen möchten, können wir das nicht allein durch den Verstand erreichen, sondern müssen mit dem Körper arbeiten. So haben wir die Möglichkeit, auf der Ebene zu arbeiten, auf der sich das Trauma auch befindet. Ein interessanter Ansatz dazu ist beispielsweise die Polyvagal-Theorie. Im therapeutischen Prozess ist es dann tatsächlich möglich, eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen.
Die Polyvagal-Theorie beschreibt den traumatischen Stress im Körper
Auch wenn die Polyvagal-Theorie noch in den Kinderschuhen steckt und in Teilen der Wissenschaft nicht anerkannt ist, bietet sie einen beachtenswerten Ansatz, um Trauma auf körperlicher und neuronaler Ebene zu beschreiben.
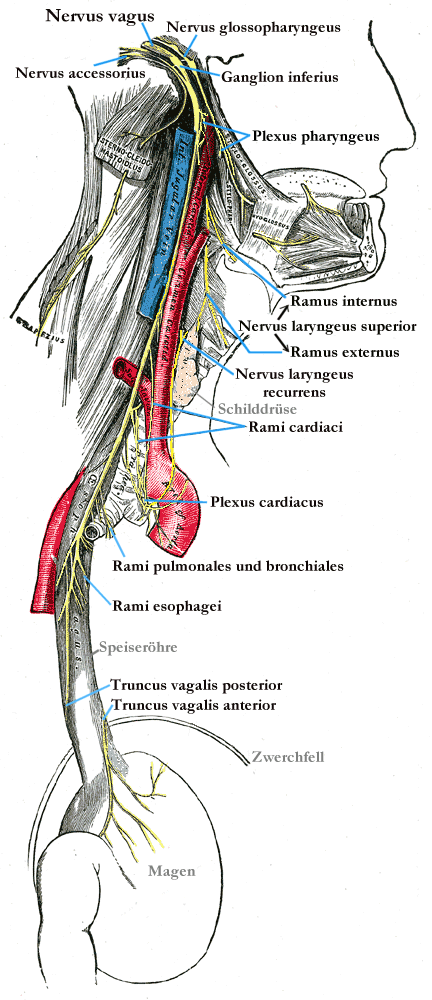
Über den Vagusnerv musizieren die Reize zwischen inneren Organen und Gehirn. In seinem großen Verbreitungsgebiet im Körper steuert der Vagusnerv die Reflexe und heißt übersetzt „der umherschweifende Nerv“. Der Vagusnerv ist aufgeteilt in einen dorsalen und ventralen Teil, d.h. hinteren und vorderen Strang, und moduliert die instinktiven Reaktionen auf soziale Akteure und speziell soziale Gefahren.
Der Vagusnerv ist ein starker Akteur des Parasympathikus und ist damit für die Entspannung und Harmonisierung des Körpers zuständig. Im Idealfall der körperlichen Ausgeglichenheit herrschen:
- Ruhepuls
- ruhige gleichmäßige Atmung
- Synchronisation zwischen Atmung und Puls
Dieser Gleichgewichtszustand wird natürlich durch Aktivität oder starke Reize verlassen. Im Fall einer Gefahr kann der Körper in eine Fight-Flight-Stressreaktion übergehen. Wir könnten damit vereinfacht folgende Zustände definieren, aufsteigend nach relativer Gefährlichkeit:
- Gleichgewicht (Homöostase)
- Flucht (flight) vor dem Reiz
- Kampf (fight) gegenüber dem Reiz
- Erstarren (freeze) oder Totstellen in Form von Immobilität
Säugetiere verlassen das Gleichgewicht (1) natürlicherweise bei gefährlichen Reizen und gehen in einen der Zustände 2-4 über. Wenn die Gefahr vorbei ist, kehrt das Nervensystem zurück ins Gleichgewicht. Diese natürlichen Prozesse können jedoch dauerhaft verzerrt sein, wenn die körpereigene Regulation gestört wurde, z.B. durch zu starke Reize oder dauerhaften Stress. Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), z.B. bei Kriegsveteranen oder nach Unfällen zeugt von einer solchen Störung.
Verallgemeinert kann gesagt werden:
Trauma = seelische Verletzung, führt zur Störung der Selbstregulation des vegetativen Nervensystems
Trauma und Psychotherapie aus Sicht der Neurobiologie
Nach dieser ganzen Problemanalyse wird es erleichternd sein zu lesen, dass die Wirksamkeit von Psychotherapie neurobiologisch ebenfalls nachgewiesen ist! Allerdings ist nicht jede Therapie gleich wirksam. Die Neurobiologie legt nahe, dass die sogenannte „therapeutische Allianz“ also die Beziehungsqualität zwischen Therapeut und Klient einer der größten Faktoren darstellt – sogar noch vor der psychotherapeutischen Ausrichtung! Letztere spielt wahrscheinlich insofern eine Rolle, als dass die Menschen und ihre Problemlagen unterschiedlich sind, sodass für den einen eine Psychoanalyse geeigneter sein mag, während für den anderen eine Verhaltenstherapie mehr Erfolg zeitigt.
„Eine für die Psychotherapie zentrale Erkenntnis betrifft die große Bedeutung der ‚therapeutischen Allianz‘ zwischen Patient und Therapeut und dem Glauben, helfen zu können bzw. Hilfe zu erhalten. Wie gezeigt, führt dies zu einer massiven Erhöhung des Oxytocinspiegels und einer dadurch erhöhten Ausschüttung von endogenen Opioiden und Serotonin sowie zu einer Senkung des Stresshormonspiegels. Diese Vorgänge innerhalb der therapeutischen Allianz machen nach einschlägigen Studien 30–70 % der schnell einsetzenden Linderung psychischen Leidens aus, wie sie für die erste Phase einer Psychotherapie typisch ist. “ (Roth, Strübel )
Sollten Sie also eine psychotherapeutische Behandlung in Erwägung ziehen, so achten sie bei den ersten Sitzungen besonders darauf, ob sie sich wohl fühlen und ob Sie das Gefühl haben, dass der oder die Therapeut*in Sie achtet und als ganzen Menschen wahrnimmt. Diese Grundlage ist für eine gelingende Therapie unentbehrlich:
„Die große Herausforderung aller gängigen Psychotherapierichtungen ist zum einen die Tatsache, dass der wichtigste Garant für einen Therapieerfolg das ‚Arbeitsbündnis‘ zwischen Therapeut und Patient zu sein scheint, und dass eine bestimmte Therapierichtung offenbar umso erfolgreicher ist, je mehr positive Bindung zwischen Patient und Therapeut besteht und je mehr beide hinsichtlich der Ziele der Behandlung und der Aufgaben, die ihnen beiden dabei zukommen, übereinstimmen.“
Quellen
[1] Antonio Damasio: Selbst ist der Mensch
[2] Gerhard Roth, Nicole Strüber: Wie das Gehirn die Seele macht
[3] Guido Flatten: Posttraumatische Belastungsstörungen
[4] Tanja Brückl, Elisabeth Binder: Folgen früher Traumatisierung aus neurobiologischer Sicht
Mehr zum Thema Persönlichkeit:
Trauma & persönliche Entwicklung | Somatic Experiencing | Spiral Dynamics | Yoga Thinking | Achtsamkeit & Meditation
Autor: Timotheus Böhme


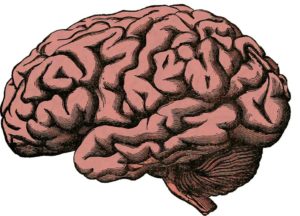 „Die traumatische Wahrnehmung bleibt auf der Ebene limbischer Verarbeitung ’stecken‘, sodass erfahrungs- und vernunftbasierte Bewertungen durch präfrontale Kortexregionen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die funktionelle Abkopplung präfrontaler Steuerungsfunktionen resultiert in:
„Die traumatische Wahrnehmung bleibt auf der Ebene limbischer Verarbeitung ’stecken‘, sodass erfahrungs- und vernunftbasierte Bewertungen durch präfrontale Kortexregionen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die funktionelle Abkopplung präfrontaler Steuerungsfunktionen resultiert in:
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie hier eine so umfangreiche und extrem gut erklärte Beschreibung zur Verfügung gestellt haben. Beim Lesen hatte ich viele „Aha-Momente“… herzlichen Dank